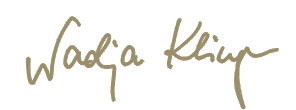Der Tagesspiegel, November 2008
In Probstzella ging es von der DDR in die BRD, hier wurde kontrolliert und schikaniert, das schlug auch den Einheimischen aufs Gemüt. Was sollen wir tun, fragen die bis heute, mit unseren Resten der Geschichte?
Was sich oben auf den Bergen abspielt, ist nur mit geübtem Blick zu sehen. Die anderthalb Tausend Menschen im Tal haben diesen Blick. Leider, sagen sie.
Im Thüringer Schiefergebirge, an dessen Hänge sich ihr Heimatdorf Probstzella schmiegt, liegt ein Band. Es fällt vom Gipfel am Ortsausgang hinunter bis zur Bahnstrecke, die in den Süden führt, zieht sich hinter den Gleisen wieder bergauf. Es ist etliche Meter breit und besteht nur aus Birken. Die Bäume sind in knapp zwei Jahrzehnten rasch herangewachsen und von anderem Grün als der Mischwald ringsum. Die Probstzellaer erkennen das, weil das Band lange Zeit ein gerodeter Streifen war. Eine Wunde in der Landschaft, die auch nicht bei Dunkelheit verschwand, weil sie grell beleuchtet wurde: die Staatsgrenze. Hinterm Band heißt das Gebirge Frankenwald. Hinterm Band ist Bayern. Sie sagen: der Westen. Weil sie sich wie das letzte Dorf im Osten fühlen, ganz am Rand. Wie früher. Obwohl früher lange her ist.
Anfang 2007 hat Marko Wolfram ein Haus ersteigert. Der dreistöckige Bau steht an den Gleisen neben Probstzellas historischem Bahnhof aus rotem Backstein. Er bezahlte 3500 Euro, bekam den Schlüssel, ging hinein. Regenwasser sickerte aus vermoderten Wänden, tropfte durch gebrochene Decken. Schimmel fraß sich durch die Etagen. Auf den Fußböden weichten Putz und andere Materialien. Wolframs Haus stank und zerfiel. Das passte in den Plan, den der Gemeinderat einstimmig gefasst hatte: ein Haus zu kaufen, um es abzureißen. Um ein Stück Grenze loszuwerden.
Seit den 70er Jahren hatten im Haus an den Gleisen Passkontrolleinheiten, Zoll und Transportpolizei der DDR den innerdeutschen Grenzverkehr abgewickelt. Wer zwischen West-Berlin und Bayern unterwegs war, kam hier vorbei. DDR-Bürger mit Reiseerlaubnis wurden zuweilen stundenlang festgehalten. Im Dorf nannte man die Grenzübergangsstelle GüSt. Das klang wie ausgespuckt. Aber Spucken nützte den Probstzellaern nicht viel. Jedes Mal, wenn der Doktor aus dem Dorf losrannte, weil ein schikanierter Reisender ohnmächtig geworden war oder einen Herzinfarkt erlitten hatte, spürten sie, dass die GüSt Teil ihres Lebens war. Sie schlug ihnen aufs Gemüt. Sie passte weder zur Landschaft noch zu den kleinen, schieferbedeckten Häusern. Sie passte überhaupt nicht in irgendeine Art von Heimat. Sie war schuld, dass niemand mehr gern durch die Bahnhofsstraße ging.
Marko Wolfram ist in Probstzella aufgewachsen. Im Sperrgebiet. Man durfte hier nur mit Stempel im Ausweis leben. Gartentore mussten verriegelt, Leitern angeschlossen werden. Selten kam Besuch, auch Verwandte mussten sich bei der Polizei melden, ehe sie an den Kaffeetisch durften, bei Waldspaziergängen wurden Ausweise kontrolliert. In Probstzella entstanden Wolframs Kinderträume. Er wollte zur See fahren.
Er war 16, als plötzlich das Licht an der Grenze in den Bergen erlosch, Sicherungsanlagen demontiert, Wachtürme gesprengt wurden. Er ging nach Jena, studierte Volkswirtschaftslehre, war in England und Frankreich, arbeitete im Deutschen Bundestag in Berlin. 2006 gewann er in Probstzella die Bürgermeisterwahl gegen seinen früheren Biologielehrer, den CDU-Mann, der seit der Wende regiert hatte. Der Marko soll uns voranbringen, sagen die Leute. Hinter der runden Brille des großen, dunkelhaarigen Bürgermeisters sitzt ein bübisches Lachen. Wolfram ist in der SPD. Er hat Geist und Niveau, sagen die Leute, er hat in der Ferne Frischluft geschnappt.
Er ist kein Seemann geworden. Aber er hat von fern auf seine Heimat geblickt. Er sieht in Probstzella nicht die Grenze, sondern den Ort, der einst von besonderem Geist erfüllt war.
Anfang des letzten Jahrhunderts baute der Sozialdemokrat Franz Itting hier ein Elektrizitätswerk. Er brachte Ostthüringen den Strom. Baute seinen Arbeitern Wohnungen, schloss Lebensversicherungen für sie ab, führte die 40-Stunden-Woche ein. Sie sollten „sinnvolles Tun, gerechten Lohn und einen erfreulichen Feierabend“ haben. 1925 baute Itting ihnen das „Haus des Volkes“. Der Bauhaus-Architekt Alfred Arndt stellte es an den Hang über der Bahnhofsstraße. Es gab Hotelzimmer, Gaststätte, Tanzsaal, Kegelbahn, Kino, Turnhalle, Heilbäder, es wurden Opern und Theaterstücke aufgeführt. „Freudig lebe, aufwärts strebe!“ stand über der Bühne im „Roten Saal“ geschrieben. Probstzella war ein Ort, wie man ihn erträumte, zugleich reales Leben.
Bis er realer Alptraum wurde. Die Nazis steckten den „Roten Itting“ ins Konzentrationslager. Kommunisten sperrten ihn nach dem Krieg als „Kapitalisten“ ins Gefängnis. Er wurde krank, enteignet, flüchtete 1950 nach Ludwigsstadt. Der gute Geist des Ortes saß nun in Oberfranken. Dort liegt auch die Fahne der SPD-Ortsgruppe, die einmal 136 Mitglieder hatte. Nach dem Krieg ist der letzte Genosse mit ihr in den Westen geflohen. Ludwigsstadt will die Fahne zurückgeben, wenn Probstzella wieder einen SPD-Bürgermeister sowie einen Ortsverband hat. Marko Wolfram könnte sich ins Auto setzen und sie holen. Es sind nur sechs Kilometer. Aber er ist der einzige Genosse im Ort.
Seit es kein Sperrgebiet mehr ist, seit Ost und West vereint sind, liegt Probstzella in der Mitte Deutschlands. ICEs rasen hier vorbei. Deutsche Bahn und Deutsche Post haben den Ort verlassen, ihre Immobilien verrotten. Das Elektrizitätswerk verlottert. Betriebe gingen ein, Handwerk starb, Geschäfte verschwanden, die Tankstelle schließt, bald geht der Arzt in Rente, einen Nachfolger gibt es nicht. Ein Fünftel der Einwohner, vor allem junge, waren gegangen, als Marko Wolfram 2006 wiederkam. Im Sommer 2008 beschloss die Gemeinde den Abriss der GüSt. Kurz drauf trudelte im Rathaus das Tourismuskonzept ein, das der Bürgermeister bestellt hatte, um zu erfahren, ob sein Ort wenigstens als Ferienort eine Chance hat.
Der letzte erhaltene innerdeutsche Grenzbahnhof sollte Museum werden, schrieben Tourismusexperten. Wolfram bestellte die Abrissfirma ab. Veröffentlichte ein Museumskonzept, ermittelte Kosten und zeigte, was er fern von Probstzella gelernt hatte: Verbündete zu suchen. Er schloss der Presse die GüSt auf, führte Fotografen durchs Haus, hielt die Lampe für die Fernsehkamera, sprach in Mikrofone. Der Schriftsteller Erich Loest appellierte an Thüringen, die GüSt zur Chefsache zu ernennen. Jemand vom Europaparlament empfahl, sich „im deutsch-deutschen Erinnerungstourismus einen Namen zu machen“. Die Landesbeauftragte für Stasiunterlagen eilte zur GüSt, zeigte sich „beeindruckt“. Karin Gueffroy, Mutter des letzten an der Mauer erschossenen Flüchtlings, sagte: „Es ist nicht zu fassen: Die reißen die ganze DDR-Vergangenheit ab!“
Jeden, den Marko Wolfram im Dorf traf, fragte er: „Was meinst du dazu?“ Die Leute verstehen nicht, warum die Museumsidee dem Bürgermeister den Kopf verdreht. Sie verstehen nicht, dass er hofft, die Bahnhofsstraße wiederbeleben zu können. Sie verstehen nicht, wo der Presserummel herkommt und die prominenten Stimmen. Die fiktive Besucherzahl von 30 000 Menschen, die angeblich bald jährlich nach Probstzella kommen. Die Leute haben keine Lust mehr, nicht zu verstehen. Sie werden laut.
So wie Henry Eichhorn, der Elektromechanikermeister im Blaumann, der den Bauhof der Gemeinde leitet. Auch er wuchs in Probstzella auf. Als an der Grenze das Licht erlosch, half er, den Weg nach Oberfranken frei zu machen, zersägte Bäume, die auf der Straße lagen, rackerte vorwärts, bis auf einmal die Bayern dastanden und winkten. Eichhorn erzählt die schöne Episode, wenn man ihn nach seinem Leben an der Grenze fragt. Er hat die Macht über seine eigene Geschichte an sich gerissen. Er ist Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr. Jeden Monat räumt er einen Spind leer, weil wieder ein junger Mann das Dorf verlassen hat. Er ist erst 44 Jahre alt, aber er spürt schon, wie etwas zu Ende geht. „Bald kann die Feuerwehr nicht mehr ausrücken“, sagt er.
Eichhorn ist als Parteiloser auf der offenen Liste der SPD im Gemeinderat. Vorm Sommerurlaub hat er für den Abriss gestimmt, nach dem Urlaub war die Museumsidee da. „Die GüSt hält junge Leute nicht, sie macht das Leben nicht attraktiv“, sagte er. Fast alle im Ort meinten das auch. Aber schon wieder ging es um Höheres als Probstzellas Meinung. Wenn Eichhorn laut wurde, schrie er gegen den Verdacht an, die Aufarbeitung der Geschichte verhindern zu wollen. Ja, er hätte Schüsse gehört! Ja, es wären Menschen auf Minen gelaufen! Aber darf man eine schlimme Geschichte, der man entkommen ist, nicht loswerden? „Wenn wir die GüSt ausbauen, können wir auch wieder Schlagbäume aufstellen!“, ruft er. „Dann setzen wir Ein-Euro-Jobber als Volkspolizisten ein und kontrollieren jeden Bus!“ Mit der GüSt wird Probstzella ewig Grenzort bleiben, sagen die Leute.
Auch Dieter Nagel ist Probstzellaer. Studierte in Jena Biomedizintechnik, arbeitete im Krankenhaus in Saalfeld. Nach der Wende gründete er im Ort eine Medizintechnikfirma. Und auch er ersteigerte 2003 ein Haus. Im Krieg war das „Haus des Volkes“ Lazarett, später saßen Staatliche Versicherung, Volkspolizei, SED- Ortsleitung und Zoll drin, seit 1961 lag der Hotelbereich brach, nach der Wende das ganze Gebäude. Nagel entrümpelte, entwässerte, mauerte, reparierte, ließ nach Vorlagen originalgetreu ausbauen. Probstzella hat nun wieder Hotel und Restaurant, eine Bowlingbahn, es wird getanzt, es gibt Kino, Lesungen, Musik, kulinarische Abende. Gäste von außerhalb gibt es nicht viele. Das Bauhaushotel „Haus des Volkes“ ist ein Risiko für Dieter Nagel. Und eine Chance für Probstzella. Probstzella weiß das, aber Chancen zu haben, ist man hier nicht gewöhnt. Man redet über Nagel, als hätte der sich ein zu großes Hobby zugelegt.
Zwei Aussiedlungen haben die Probstzellaer erlebt. 1952 und 1961 wurden ?politisch Unzuverlässige“ von hier ins Landesinnere geschafft. Die zurückblieben, trauten sich kaum, einen politischen Witz zu machen. Ihr Heimatdorf war nicht wirklich Heimat, denn an der Grenze waren sie der Feind. Seit 1961 die letzten Urlauber abreisten, waren sie unter sich. Nur einmal noch kamen viele Menschen, verstopften die Straße in den Westen, um Begrüßungsgeld zu holen. Eine blaugraue Abgaswolke hing in den Vorgärten. Die Vorstellung, dass jedes Jahr 30 000 Fremde anrücken könnten, hat etwas Bedrohliches. Wo sollen die parken?, fragt jemand im Gemeinderat.
Der Dialekt, den der kleine, hagere Mann in Jeans und Pullover und mit spärlicher Haartracht spricht, verbindet ihn mit den meisten Leuten im Ort. Mit wenigen verbindet ihn mehr. „Die Leute fühlen sich hier mehr als Ossis als die Ossis anderswo“, sagt er. Nagel wünscht sich das Museum in der GüSt. Er wünscht sich Gäste. In diversen Zeitungen konnte man das lesen. Uns hat keine Zeitung erst gefragt, meckern die Leute. Dabei hat Nagel den Sonderplatz in der Debatte verdient. Wenn sein „Haus des Volkes“ voll ist, lebt Probstzellas schönste Vergangenheit wieder auf. Wer so viel für den Ort tut, hat eigentlich einen Wunsch frei.
Bislang haben sich weder Thüringer Landesregierung noch Bundesregierung in Probstzella gemeldet, um das Museum in der GüSt zu finanzieren. Selbst wenn er nur das Erdgeschoss herrichten würde, bräuchte Marko Wolfram 300 000 Euro. Er ruft den Gemeinderat zur Sondersitzung, um erneut abzustimmen. Ungewöhnlich viele Leute drängen mit in den Raum. Der Bürgermeister lässt sie alle reden.
Nach der Grenzöffnung haben sie gewartet, was mit der GüSt passiert. 19 Jahre hatte Probstzella Zeit, den Bau zu stürmen und abzubrennen. Das wäre ungesetzlich gewesen, aber autonomes Handeln. Nach heftiger Debatte im Gemeindesaal stimmen die Volksvertreter erneut für Abriss. Auch der Bürgermeister. Sollte sich noch ein Geldgeber im Rathaus melden, wird er ins Auto springen und die Abrissfirma stoppen. Bübisches Lachen. Es scheint, als hätte Marko Wolfram seine Freude. Er sagt: „So mobil habe ich Probstzella noch nie erlebt.“
Nadja Klinger